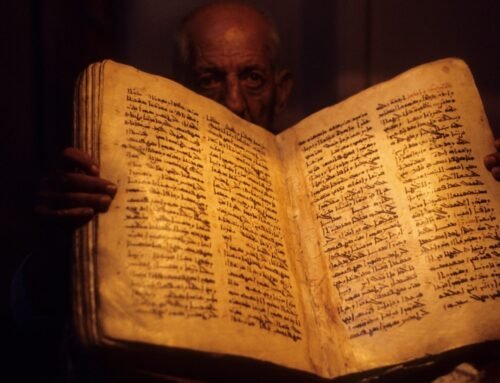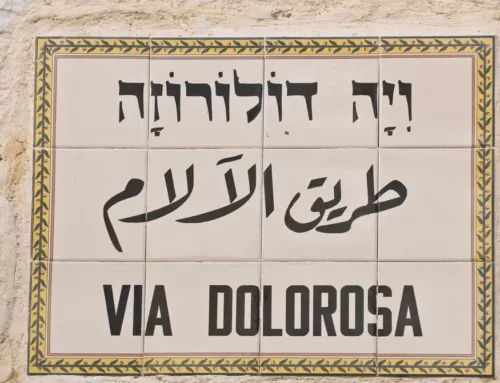Teile diese Geschichte auf deiner Plattform!
Nicht zufällig beginnt das Neue Testament mit der Aussage „Βίβλος γενέσεως Ἰησοῦ Χριστοῦ/Biblos geneseos Jesu Christu“, was übersetzt so viel heißt, wie „Buch der תֹולְדֹות/toledot von Jesus, dem Messias“ (Matthäus 1,1). Das hebräische Wort תֹולְדֹות/toledot ist ein „Grund-legender“ Begriff in der Heiligen Schrift.[1] Deshalb muss Entscheidendes verloren gehen, wenn wir diesen Begriff übergehen, nicht zutreffend verstehen oder gar missverständlich übersetzen.
Um das gleich vorweg zu nehmen: Wer diese allererste Aussage im Neuen Testament bislang als Überschrift über den Stammbaum Jesu oder vielleicht sogar als literarische Gattungsbezeichnung für Matthäus 1,1-17 verstanden hat, hat ihn ziemlich sicher missverstanden.
Weichen-stellende Schriftstellen
1. Mose 2,4 berichtet „אֵלֶּה תֹולְדֹות הַשָּׁמַיִם וְהָאָרֶץ בְּהִבָּרְאָם/eleh toledot haschamajim veha’aretz behibare’am“. Luther (1984) verdeutschte sinnreich: „So sind Himmel und Erde geworden, als sie geschaffen wurden.“ Die revidierte Elberfelder versucht es mit: „Dies ist die Entstehungsgeschichte der Himmel und der Erde, als sie geschaffen wurden.“ Martin Buber und Franz Rosenzweig meinen[2]: „Dies sind die Zeugungen des Himmels und der Erde: ihr Erschaffensein.“
Wenn ich den Begriff „תֹולְדֹות/toledot“ vorläufig einmal unübersetzt lasse, steht in 1. Mose 2,4 wörtlich: „Dies sind die תֹולְדֹות/toledot der Himmel und des Landes, als sie geschaffen wurden.“
In 1. Mose 5,1 folgen auf die תֹולְדֹות/toledot des Himmels und des Landes die תֹולְדֹות/toledot des Menschen: „זֶה סֵפֶר תֹּולְדֹת אָדָם/seh sefer toledot Adam“ – „Dies ist das Buch der תֹולְדֹות/toledot des Adam“.
Diese einzigartige Formulierung hat der Evangelist Matthäus dann offensichtlich für die Einleitung seines Evangeliums gewählt und dabei Jesus an die Stelle von Adam gesetzt.
Mit der Überschrift von 1. Mose 5,1 wird die Aussage unterstrichen, dass Mann und Frau gemeinsam als Mensch in der Ähnlichkeit Gottes erschaffen wurden, und dass der Schöpfer sie segnete und ihnen gemeinsam den Namen „Adam“, „Mensch“, gab.
Darauf folgt eine Geburtenfolge von Adam bis zu den Söhnen Noahs: Sem, Ham und Jafet – mit auffallend genauen Altersangaben.
Die jüdische Tradition gelangt aufgrund dieser ersten beiden Vorkommen des Begriffes תֹולְדֹות/toledot zu der Einsicht, dass ein einzelner Mensch ebenso wichtig sein muss wie das gesamte Werk der Schöpfung. Woraus der berühmte Satz gefolgert wird: „Wer einen Menschen tötet, tötet eine ganze Welt.“
Weiter entspinnt sich daraus eine Diskussion um das Gebot, das laut Jesus das höchste ist (Markus 12,28-34) – wobei Schimon Ben Asai aus der zweiten Generation der Tannaiten (erstes Drittel des zweiten Jahrhunderts unserer Zeitrechnung) Rabbi Akiva, der ähnlich wie Jesus argumentiert hatte, widerspricht. Ben Asai meinte, die תֹולְדֹות/toledot Adams seien noch wichtiger. Schließlich gehe es dabei nicht nur um den Nächsten, sondern um den Menschen überhaupt. Ganz gleich ob Jude oder Nichtjude: jeder Mensch sei gleichermaßen im Bilde Gottes erschaffen.[3]
Zum dritten Mal erscheint der Begriff תֹולְדֹות/toledot dann in 1. Mose 6,9, wo unter der Überschrift אֵלֶּה תֹּולְדֹת נֹחַ/eleh toledot Noach die so genannte Sintflutgeschichte erzählt wird.
Darauf folgen die תֹולְדֹות/toledot der Söhne Noahs (1. Mose 10,1), gemeinhin als Völkertafel bezeichnet: Eine Zusammenfassung der Stämme, Stammesverbände und Völker, die sich nach der Sintflut über die Erde ausbreiten.
Die תֹולְדֹות/toledot Sems (1. Mose 11,10) schließen sich unmittelbar an den Turmbau zu Babel an und stellen eine Verbindung her von Sem bis zu den Söhnen des Terach: Abram, Nahor und Haran.
Die תֹולְדֹות/toledot Terachs (1. Mose 11,27) handeln von Terachs Familie, den verwandtschaftlichen Zusammenhängen und ihrem Auszug aus Ur in Chaldäa mit dem Ziel des Landes Kanaan. Allerdings endet dieses Unterfangen in Haran, wo Terach stirbt.
Die gesamte Abrahamsgeschichte steht unter dieser Überschrift „וְאֵלֶּה תֹּולְדֹת תֶּרַח/ve’eleh toledot Terach“, weil die nächsten תֹולְדֹות/toledot erst in 1. Mose 25,12 auftauchen.
Es gibt in der Bibel also keine „תֹולְדֹות/toledot Abrahams“ – was angesichts der außerordentlich bedeutenden Rolle, die dieser Mann spielt, und seiner Wirkungsgeschichte, die weit über das Neue Testament hinaus bis in unsere Zeit hinein reicht, bemerkenswert ist.
In 1. Mose 25,12 ist von den תֹולְדֹות/toledot des Abrahamssohnes Ismael die Rede, der von der Ägypterin Hagar geboren worden war. Seine Großfamilie wird letztendlich zu einem Zwölfstämmevolk, das in den Wüstengebieten südlich des verheißenen Landes beheimatet ist.
Wenige Verse später ist dann gleich noch von „וְאֵלֶּה תֹּולְדֹת יִצְחָק בֶּן־אַבְרָהָם/ve’eleh toledot Jitzchak ben Avraham“ („dies sind die תֹולְדֹות/toledot Isaaks, des Sohnes Abrahams“) die Rede (1. Mose 25,19)[4], einer Zusammenfassung nicht etwa der Geschichte Isaaks, sondern der Ereignisse um das Brüderpaar Esau und Jakob.
1. Mose 36 erwähnt die תֹולְדֹות/toledot Esaus, „das ist Edoms“ (Vers 1), beziehungsweise, „des Vaters von Edom auf dem Gebirge Seir“ (Vers 9). Dass die תֹולְדֹות/toledot Esaus gleich zweimal kurz aufeinander erwähnt, das heißt eigentlich, betont werden, fällt auf, weil es einzigartig ist.
Dieses Kapitel zeichnet den Aufbau der Nachkommenschaft Esaus nach, verwurzelt die Großfamilie geographisch im südlichen Ostjordanland und skizziert einen Stammesverband, der später immer wieder als Edom bezeichnet wird.
Die תֹולְדֹות/toledot Jakobs (1. Mose 37,2) schließlich, bezeichnen wiederum weder eine Genealogie noch einen Stammbaum. Auch beginnen sie nicht mit der Geburt Jakobs (1. Mose 25,26), sondern mit der Geburt des alles entscheidenden Sohnes von Jakob.
Die תֹולְדֹות/toledot Jakobs erzählen die Geschichte Josefs und seiner Brüder, durch die im ägyptischen Exil die Grundlage dafür gelegt wurde, dass aus dem losen Verband einer Großfamilie, die im Laufe der Zeit zu Sklaven geworden war, letztendlich das Volk der Hebräer entstand.
In 1. Mose 32,29 war der Name „Israel“ erstmals gefallen, als dem Stammvater Jakob am Jabbok gesagt worden war: „Du sollst nicht mehr Jakob heißen, sondern Israel.“
Vom letzten Vorkommen des Begriffes תֹולְדֹות/toledot im ersten Buch der Bibel her gedacht, ist es tatsächlich so, dass diese תֹולְדֹות/toledot auf Israel zulaufen.[5] Insofern liegt es nicht fern, Zweck und Sinn aller תֹולְדֹות/toledot darin zu finden, die Herkunft der בני ישראל/bene Jisrael („Söhne Israels“) festzustellen.[6]
Eine Strukturmarkierung
Die rabbinische Tradition ist der Ansicht, dass die Thora nicht in einem Zug geschrieben, sondern Mose „Schriftrolle für Schriftrolle übergeben“ worden war (תורה מגילה מגילה נתנה/torah megillah megillah nitnah).
Die Formel „אֵלֶּה תֹּולְדֹת/eleh toledot,“ „dies sind die תֹולְדֹות/toledot,“ kommt zehnmal im 1. Buch Mose vor. Jedesmal beginnt ein neuer Abschnitt, so dass jede Schriftrolle, jedes „Buch“ mit dieser Aussage anfängt. „Dies erklärt auch, warum einige Abschnitte einleitende Verse haben, welche Tatsachen, die in früheren Abschnitten erwähnt sind, ins Gedächtnis rufen oder zusammenfassen.“[7]
Offensichtlich gliedert der Ausdruck תֹולְדֹות/toledot die so genannte Urgeschichte. Er hat die Funktion einer strukturellen Markierung in der Erzählung des Verlaufs von der Schöpfung bis zum auserwählten Volk, den das erste Buch Mose nachzeichnet.[8]
Yael Ziegler kommt zu dem Schluss: „Das letzte Auftreten des Ausdrucks אֵלֶּה תֹּולְדֹת/ve’eileh toledot im 1. Buch Mose bezieht sich auf Jakob (1. Mose 37,2). Das bedeutet, dass die Zeit der Filterung vorbei ist. Von diesem Zeitpunkt an sind alle Nachkommen Jakobs Teil des auserwählten Volkes.“[9]
Zusammenfassung oder Überschrift?
Schon ein flüchtiger Blick auf 1. Mose 2,4 hatte gezeigt, dass sich Herausgeber von Bibelausgaben, Bibelübersetzer und Ausleger nicht einig sind, ob es sich bei dem Begriff אֵלֶּה תֹולְדֹות/eleh toledot, der in der Bibel nur im Plural vorkommt,[10] um eine Zusammenfassung des Vorhergehenden oder um eine Überschrift des Folgenden handelt.
Überhaupt spricht die Bibel nie abstrakt und theoretisch von irgendwelchen תֹולְדֹות/toledot. Das Wort steht an keiner Stelle allein, objektiv, ohne Bezug im Raum, sondern ist ausschließlich – im Status constructus oder mit einem Suffix[11] – auf eine Person oder Personengruppe bezogen – außer in 1. Mose 2,4, wo es nicht um Personen, sondern um Himmel und Erde geht.
Bei der Frage nach einer Funktion des Begriffes als Überschrift, ist zuerst einmal festzuhalten, dass sich אֵלֶּה/eleh („diese“) zu Beginn eines Abschnittes „in der Regel auf das Folgende“ bezieht.[12] Es scheint sogar möglich zu sein, ganz allgemein zu sagen, dass „אֵלֶּה תֹולְדֹות/eleh toledot“ („diese sind die toledot“) „stets Überschrift“ ist,[13] sich als Einleitungsworte „immer auf das Folgende“ beziehen.[14]
Das einzige Problem bei einer grundsätzlichen Erklärung von אֵלֶּה תֹולְדֹות/eleh toledot als Überschrift bereitet das Vorkommen dieses Ausdrucks in 1. Mose 2,4: „Dies sind die תֹולְדֹות/toledot der Himmel und der Erde.“
Wenn wir mit der antiken jüdischen Übersetzung des Alten Testaments, der Septuaginta (LXX), sagen „Αὕτη ἡ βίβλος γενέσεως/Haute he biblos geneseos“ („dies ist das Buch der Genesis“), müssen wir feststellen, dass der Text von der Entstehung des Himmels und der Erde nach dieser Überschrift nichts weiter berichtet – zumal die Erschaffung von Himmel und Erde in 1. Mose 2,1 expressis verbis für abgeschlossen erklärt worden war.
An keiner einzigen Stelle beschreiben die תֹולְדֹות/toledot eine Entstehung, nirgends den Stammbaum oder die Genealogie der jeweils genannten Person, sondern immer die Folgen, die Konsequenzen ihrer Existenz. Genauso „können auch die תֹולְדֹות/toledot des Himmels und der Erde nicht den Ursprung und die Entstehung des Weltalls erzählen, sondern nur was mit dem Himmel und der Erde nach ihrer Schöpfung weiter geworden ist.“[15]
Samson Raphael Hirsch unterstreicht, dass es „keinen ungeeigneteren Ausdruck für [die] Entstehung“ von Himmel und Erde gäbe. Vielmehr gehe es bei den תֹולְדֹות/toledot um „die natürlichen Erzeugnisse des Himmels und der Erde“, das heißt, „es umfasst dies Alles, was nun nach der Schöpfung sich durch das Zusammenwirken des Himmels und der Erde erzeugt.“[16]
Zwei weitere תֹולְדֹות/toledot
Außerhalb des 1. Buches Mose finden wir noch zwei weitere bemerkenswerte Vorkommen des Begriffes תֹולְדֹות/toledot:
In 4. Mose 3,1 wird unter der Überschrift „וְאֵלֶּה תֹּולְדֹת אַהֲרֹן וּמֹשֶׁה/ve’eleh toldot Aharon veMosche“ („dies sind die תֹולְדֹות/toledot Moses und Aarons“) die besondere Berufung und Beauftragung der Priester und Leviten im Volk Israel zusammengefasst.
Und in Ruth 4,18, dem zwölften Vorkommen dieses Begriffes auf diese Weise, wird nach der Einleitung „וְאֵלֶּה תֹּולְדֹות פָּרֶץ/ve’eleh toldot Paretz“ („dies sind die תֹולְדֹות/toledot des Peretz“) die Buchrolle Ruth abschließend zusammengefasst, indem die genealogische Verbindung von Peretz, dem Sohn Judas, über Boas bis zu König David gezogen wird. Das alles entscheidende Verbindungsglied in dieser Geschichte ist die Moabiterin Ruth, die sich ihrer verbitterten Schwiegermutter Naomi in liebevoller Loyalität angeschlossen hatte.
Wenn der Ausdruck אֵלֶּה תֹּולְדֹת/eleh toledot die Linie von der Schöpfung zum auserwählten Volk nachzeichnet und strukturiert, sollte es nicht erstaunen, dass in 4. Mose 3,1 der Ausgangspunkt der Priesterlinie und in Ruth 4,18 die Grundlage des Königshauses mit אֵלֶּה תֹּולְדֹת/eleh toledot vorgestellt werden.[17] Beide Dynastien spielen auf dem Weg des Gottesvolkes von der Schöpfung zur Neuschöpfung eine entscheidende Rolle.[18]
Darüber hinaus gibt es dann noch Vorkommen des Wortes תֹולְדֹות/toledot in der Bibel, wo bedeutende Menschen, Familien oder Stämme „entsprechend ihren Namen, ihren תֹולְדֹות/toledot, ihren Familien, ihren Vaterhäusern, ihren Völkern“[19] in einen historischen Zusammenhang gestellt werden.
Zweifellos denkt die Thora die Geschichte eines Volkes nicht in Jahrhunderten, sondern in Vätern und Söhnen.[20] Zuweilen mag die Überschrift אֵלֶּה תֹולְדֹות/eleh toledot tatsächlich auch zurückgreifen.[21] Dann nehmen die תֹולְדֹות/toledot eine historische Einordnung vor, stellen eine Person oder Personengruppe in einen Zusammenhang, und zwar nicht selten in einen Zusammenhang von Ursache und Wirkung.
Die Herkunft eines Menschen, seine Prägungen und seine ganz persönliche Geschichte bestimmen seinen Charakter. Mit jedem Namen ist eine Geschichte verbunden. Bei den תֹולְדֹות/toledot geht es um das Handeln Gottes mit Menschen, Familien, Großfamlien, Clans, Stämmen, Stammesverbänden, Völkern.
Es geht darum, wie Gott selbst die Mentalität, die Denkweise, den Charakter, die Kultur und nicht zuletzt auch die Religion oder Theologie von Menschen prägt – und welche Entscheidungen, Denkstrukturen, Verhaltensweisen auf Seiten der Menschen daraus erwachsen.
All das ist kein Zufall, sondern Ergebnis des gezielten Handelns des Schöpfers – durch natürliche Entwicklung genauso, wie durch direktes Eingreifen, „übernatürliche“ Wunder, durch Leistungen und Erfolge, aber auch durch Versagen, Verfehlung und Schuld.
Bei תֹולְדֹות/toledot geht um Bestimmung und Berufung – und dann vor allem auch darum, dass Menschen ihrem Schöpfer nicht willenlos ausgeliefert sind, ergo, so etwas ähnliches wie Marionetten wären. Vielmehr sind sie dazu bestimmt und berufen, etwas aus dem zu machen, was der eine, wahre, lebendige Gott in ihr Leben hineingelegt hat.
Der Wortstamm ילד/jalad
Zweifelsohne ist das Wort תֹולְדֹות/toledot von der hebräischen Wortwurzel „ילד/jalad“ abgeleitet, die laut Lexika so viel bedeutet wie „gebären“, „[er-]zeugen“, „geboren werden“, „hervorbringen“.
Im Hintergrund der Bedeutung dieses Wortes steht also die Erfahrung einer Geburt, eines Ereignisses, das lange vorbereitet wurde. Diese Vorbereitung ist – bewusst oder unbewusst – ein anstrengender Prozess, der von den Beteiligten, am meisten von der Mutter, aber auch von dem Neugeborenen, viel fordert. Die Geburt selbst ist ein Geschehen, das mit harter Arbeit, viel Schweiß, Schmerz, Blut, Angst – und manchmal sogar Tod – durchlitten werden muss. Der Beginn eines neuen Lebens prägt das Leben der Eltern unausweichlich und unumkehrbar.
Die Septuaginta (LXX) gibt תֹולְדֹות/toledot einmal mit „γενεά/genea“[22], dann mit „συγγένεια/συγγενία/syngeneia/syngenia“[23], und schließlich an den für uns besonders interessanten Stellen mit „γένεσις/genesis“[24] wieder. Dabei übersetzt sie die תֹולְדֹות/toledot in 1. Mose 2,4 kurzerhand mit „ἡ βίβλος γενέσεως/he biblos geneseos“. Das heißt, die LXX fügt „das Buch“ einfach hinzu und präsentiert so diese Überschrift – missverständlich! – als „Das Schöpfungsbuch von Himmel und Erde“.
Das hebräische Wort תֹולְדֹות/toledot wird von klassischen Übersetzern[25] im Deutschen mit „Zeugungen“, dann konkreter mit „Geschlechter“, „die Gezeugten“ oder „Sprößlinge“[26] wiedergegeben.
In seinem Kommentar zu 1. Mose 5,1 spricht Joseph Herman Hertz von „Nachkommen“,[27] andere von „Geschlechtsfolge“, „Geschlechtsgeschichte“, „Generationen“, einer „Familiengeschichte“ oder einem „Familienregister“[28], „die Nachkommenschaft Jemandes, die Entwicklung der Zeugungen, die Geschichte der Gezeugten, das was mit ihnen vorgeht, was sie tun und vollbringen“.[29]
Dies wird noch unterstrichen von der Beobachtung, dass der auf die תֹולְדֹות/toledot folgende Genetiv immer nur den Vater bezeichnet,[30] ihr Gegenstand dann allerdings nicht die Eltern sind, sondern die Kinder.[31] So betonen Keil und Delitzsch: „in keinem Falle [ist es] die Geburts- oder Entstehungsgeschichte des genitivisch Genannten, sondern immer dessen Zeugungs- und Lebensgeschichte.“[32]
Da das erste Vorkommen dieses Wortes in 1. Mose 2,4 von den תֹולְדֹות הַשָּׁמַיִם וְהָאָרֶץ/toledot des Himmels und der Erde spricht, fühlte sich Gesenius gedrungen – vielleicht auch mit Blick auf und in Anlehnung an die LXX –, noch eine dritte, uneigentliche Kategorie einzuführen und „das Hervorbringen“ als Bedeutung anzugeben. Aber so wirklich sinnvoll erscheint das dann immer noch nicht, wenn dort stehen soll: „Dies ist das Hervorbringen des Himmels und der Erde…“, zumal Hervorbringen ein Singular ist, während die תֹולְדֹות/toledot im Plural dastehen.
Die Bedeutung von hebräischen Stammformen
In 1. Mose 4 und 5 kommt die Wortwurzel ילד/jalad nicht nur auffallend häufig vor – sondern findet im Hebräischen auch eine Anwendung, die im Deutschen nur sehr schwer entsprechend auffällig widergegeben werden kann. Ich will versuchen, das zu erklären.
Das Hebräische verwendet dieselbe hebräische Wurzel in unterschiedlichen Stammformen, um so verschiedene Aspekte einer Tätigkeit zum Ausdruck zu bringen. Konkret wird in 1. Mose 4,1.2.17 gesagt, dass die Frauen Adams und Kains gebaren (Wortwurzel ילד/jalad in der Stammform Qal). Dabei liegt der Nachdruck darauf, was die Mütter bei der Geburt durchmachen, beziehungsweise auch die Kinder, wenn sie auf die Welt kommen. Dasselbe gilt dann auch noch einmal für Vers 25 desselben Kapitels, wo die Geburt des Seth erstmals erwähnt wird.
In 1. Mose 4,18 fällt der Gebrauch der Wortwurzel ילד/jalad in der Stammform Nif’al auf, die einen passiven Aspekt zum Ausdruck bringt: „Dem Henoch wurde Irad geboren.“ Die Verwendung des Nif’al deutet an, dass diese Geburt eher unbeabsichtigt, möglicherweise zufällig oder sogar gegen den Willen des Vaters geschehen ist.
In 1. Mose 4,18 wird die Kain-Linie nachgezeichnet und erzählt, dass Irad irgendwie die Geburt von Mechujaël verursachte, Mechujaël daran beteiligt war, dass Metuschaël geboren wurde, und Metuschaël der Vater von Lamech wurde. In allen Fällen wird die Wortwurzel ילד/jalad in der Stammform Qal verwendet. Der Nachdruck liegt auf den Mühen der Kinder bei ihrer Geburt, zumal die Mütter überhaupt nicht erwähnt werden.
Dieselbe grammatikalische Form von ילד/jalad wird dann auch in den Versen 20 und 22 verwendet, wobei dort allerdings die jeweils gebärende Mutter hervorgehoben wird.
Interessant und in diesem Zusammenhang bemerkenswert ist, dass zum Abschluss von Kapitel 4 in Vers 26 die Geburt des Enosch mit einer Passivform berichtet wird: Im Pu’al, einer passiven Stammform, die intensiver ist als der ebenfalls passive Nif’al.
Kapitel 5 des 1. Buches Mose setzt – so der Eindruck – nach einem tiefen Luftholen ganz neu, bewusst und nachdrücklich mit dem Gebrauch der Wortwurzel ילד/jalad ein, unter der Überschrift, dass dies das Buch der תֹולְדֹות/toledot des Adam ist (Vers 1).
Die erste Aussage ist, dass Adam im Alter von 130 Jahren die Geburt seines Sohnes „in seiner Ähnlichkeit, wie sein Bild“ verursachte, um ihm dann den Namen Seth zu geben (Vers 3).
Hier wird die Wortwurzel ילד/jalad nicht in den Stammformen Qal oder Nif’al wie in Kapitel 4 durchgehend verwendet, sondern in der Stammform Hif’il. Das Wort ילד/jalad im Hif’il besagt, dass der Vater aktiv, bewusst und gezielt die Geburt des Kindes verursacht, das heißt, einen Menschen „geboren werden macht“ oder eben, wie es meistens korrekt wiedergegeben wird, „zeugt“.
In 1. Mose 5 kommt die Wurzel ילד/jalad abgesehen von den תֹולְדֹות/toledot in der Überschrift insgesamt 28 Mal vor – ausnahmslos im Hif’il. Weder diese Fülle von Vorkommen, noch der auffallende Gegensatz zu Kapitel 4 können Zufälle sein.
Diese Unterschiede in der Verwendung der Wortwurzel ילד/jalad im hebräischen Text des vierten und fünften Kapitels der Bibel könnten andeuten, dass die Thora einen Unterschied im Verhalten zwischen der Familie des Kain und der Familie des Seth feststellt. Während sich die Kain-Linie ihrem Sexualtrieb ausgeliefert sieht, dem entsprechend passiv ist und mehr oder weniger zufällig entwickelt, befolgt die Seth-Linie mit ihrer Fortpflanzung ganz bewusst, aktiv und zielorientiert einen göttlichen Auftrag.
Die תֹולְדֹות/toledot als Hif’il-Substantiv
Der Begriff תֹולְדֹות/toledot ist eindeutig nicht von den Stammformen Qal oder Nif’al, auch nicht von den Stammformen Pi’el oder Pu’al, sondern „als hifilisches nomen von הֹולִיד/holid gebildet“.[33] Diese Tatsache, dass תֹולְדֹות/toledot das Substantiv einer Hif’il-Stammform ist, deutet darauf hin, dass der Einzelne seinen תֹולְדֹות/toledot nicht einfach nur hilflos ausgeliefert ist.
Eine Genealogie, eine Reihe von (positiv oder negativ) prägenden Vorvätern, einen Stammbaum, eine Familie, eine Sippe, ein Volk, eine Kultur, in die ein Mensch hineingeboren wurde, kann man retrospektiv nicht mehr ändern. Der Einzelne ist seiner Herkunft und der Prägung, die er dadurch erfahren hat, zunächst einmal hilflos ausgeliefert.
Das Hif’il von ילד/jalad im Gegensatz dazu bedeutet „gebären machen“, „eine Geburt [bewusst und gezielt] herbeiführen“, „hervorbringen“, „zeugen“, und verweist auf eine aktive und schöpferische Gestaltungsmöglichkeit, die dem Einzelnen im Blick auf seine תֹולְדֹות/toledot eingeräumt ist.
Benno Jacob[34] erklärt die תֹולְדֹות/toledot als Übergang vom göttlichen ברא/bara [= schaffen], בנה/banah [= bauen; etwa in 1. Mose 2,22] und עשה/asah [= machen, fertigstellen] zum menschlichen ילד/yalad [= gebären] und הוליד/holid [= gebären machen/lassen].
Deshalb bewahren die תֹולְדֹות/toledot zwar einerseits ein Bewusstsein für das Handeln Gottes in der Geschichte und für den Einfluss von Vorfahren auf das Leben eines Einzelnen, weisen gleichzeitig aber jeden Fatalismus im Blick auf geschichtliche, kulturelle und soziale Vorprägungen entschieden in ihre Schranken.
Der Zukunft entgegen
So wie der Schöpfer sich selbst ab einem bestimmten Punkt zurücknahm und vom Erdboden erwartete, Pflanzen oder Tiere hervorzubringen (1. Mose 1,11.12.24), möchte Er auch den Menschen in sein Schöpfungshandeln aktiv mit einbeziehen, etwa mit der Anordnung: „Seid fruchtbar, werdet viele, füllt das Land, erobert es und verwaltet…“ (1. Mose 1,28).
Der lebendige Gott macht es zu einem der Grundprinzipien Seiner Schöpfung, dass die Schöpfungswerke selbst sobald irgend möglich aktiv und selbst-bewusst Werkzeuge Seines Handelns werden. Deshalb ist es nur logisch, dass unmittelbar auf die תֹולְדֹות/toledot des Himmels und der Erde (1. Mose 2,4) die תֹולְדֹות/toledot Adams folgen (1. Mose 5,1).
Konkret bedeutet das: Nach hebräisch-biblischem Verständnis ist der einzelne Mensch seinen תֹולְדֹות/toledot nicht hilflos ausgeliefert, sondern er hat eine Möglichkeit sie zu gestalten. Dazu wurde er von Anfang an geschaffen, berufen, begabt und aufgefordert (1. Mose 1,26.28). Zu diesem Zweck wurde der Mensch mit einer atemberaubenden Autorität ausgestattet (Psalm 8,6-9). Auf diese Aufgabe hin wurden wir vom Messias Jeschua erlöst (Epheser 2,8-10) und darüber werden wir auch eines Tages Rechenschaft ablegen müssen.
Wenn Himmel und Erde תֹולְדֹות/toledot haben, dann bedeutet das: „Gott hat sie erschaffen. Aber nicht als etwas Statisches und Fertiges. Vielmehr auf eine Zukunft hin, die sich erst noch (in der Thora und in der Wirklichkeit) entwickeln wird, und zwar in den folgenden תֹולְדֹות/toledot. Man kann auch sagen: Gott erschuf Himmel und Erde auf eine Verheißung und Hoffnung hin.“[35]
Zurück zum Beginn des Neuen Testaments
Wie also ist – um noch einmal ganz zum Beginn dieses Artikels zurückzukehren – die Aussage von Matthäus 1,1 (Βίβλος γενέσεως Ἰησοῦ Χριστοῦ/Biblos geneseos Jesu Christu = Buch der תֹולְדֹות/toledot von Jesus, dem Messias) auf dem Hintergrund der hier zusammengefassten Beobachtungen richtig zu verstehen?
Ich denke, jedem dürfte jetzt klar sein, dass die תֹולְדֹות/toledot nicht „der Stammbaum“ oder „die Abstammung“ oder „die Genealogie“ oder gar „die Schöpfungsgeschichte“ sind. Vielmehr sind תֹולְדֹות/toledot „Existenzkonsequenzen“ – und das Matthäusevangelium erzählt ganz schlicht die Existenzkonsequenzen von Jesus, dem Messias.
Vielleicht sollten wir hier aber nicht nur den Evangelisten Matthäus sehen, der sein literarisches Werk unter eine Überschrift gestellt hat, sondern darüber hinaus auch die christlichen Redaktoren, die – unter der Leitung des Heiligen Geistes – entschieden haben, dass das Matthäusevangelium zum ersten Buch des Neuen Testaments wurde. Dann wäre das gesamte Neue Testament als Βίβλος γενέσεως Ἰησοῦ Χριστοῦ/Biblos geneseos Jesu Christu, das heißt, als Buch der Existenzkonsequenzen von Jesus, dem Messias, zu sehen – was die weltweite Christenheit ja auch in den zurückliegenden zwei Jahrtausenden in der Praxis bereits getan hat.
Fußnoten:
[1] Manchen Gedankenanstoß habe ich von Ricklef Münnich <info@ahavta.com> in einer E-Mail vom Sonntag, den 27. November 2022 10:00 AM „Ausgabe #150“ mit dem Titel „ahavta+ || Zeugungen“.
[2] Die fünf Bücher der Weisung, in Die Schrift. Verdeutscht von Martin Buber gemeinsam mit Franz Rosenzweig (Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft, 10., verbesserte Auflage der neubearbeiteten Ausgabe von 1954, 1976/1992), 12.
[3] Ricklef Münnich <info@ahavta.com> in einer E-Mail vom Sonntag, den 27. November 2022 10:00 AM „Ausgabe #150“ mit dem Titel „ahavta+ || Zeugungen“ – mit Verweisen auf den Midrasch Avot deRabbi Natan 31,3 und den Jerusalemer Talmud Nedarim 9:4.
[4] Vergleiche zu diesen beiden Vorkommnissen des Begriffs תֹולְדֹות/toledot auch noch 1. Chronik 1,29 im Kontext.
[5] Ricklef Münnich <info@ahavta.com> in einer E-Mail vom Sonntag, den 27. November 2022 10:00 AM „Ausgabe #150“ mit dem Titel „ahavta+ || Zeugungen“.
[6] Benno Jacob, Das Buch Genesis, herausgegeben in Zusammenarbeit mit dem Leo Baeck Institut (Stuttgart: Calwer Verlag, 2000. Nachdruck des im Jahre 1934 im Schocken Verlag, Berlin erschienen Werkes: Das erste Buch der Tora. Genesis. Übersetzt und erklärt von Benno Jacob), 72.
[7] Joseph Herman Hertz, Pentateuch und Haftoroth. Hebräischer Text und deutsche Übersetzung mit Kommentar, Band 1: Genesis (Zürich: Verlag Morascha, 1984), 42.
[8] Derek Kidner, Genesis. An Introduction and Commentary, TOTC (Leicester/England and Downers Grove, Illinois/USA: Inter-Varsity, 1989), 59. Yael Ziegler, Ruth. From Alienation to Monarchy. Yeshivat Har Etzion. Maggid Books (Jerusalem: Koren Publishers, 2015), 456-457.
[9] Yael Ziegler, Ruth. From Alienation to Monarchy. Yeshivat Har Etzion. Maggid Books (Jerusalem: Koren Publishers, 2015), 457.
[10] C.F. Keil and F. Delitzsch, The Pentateuch: Genesis, Exodus 1-11, Commentary on the Old Testament vol.1/1. Translated by James Martin (Peabody, Mass/USA: Hendrickson, 1989), 70.
[11] C.F. Keil and F. Delitzsch, The Pentateuch: Genesis, Exodus 1-11, Commentary on the Old Testament vol.1/1. Translated by James Martin (Peabody, Mass/USA: Hendrickson, 1989), 71.
[12] Samson Raphael Hirsch, Die Fünf Bücher der Tora mit den Haftarot, übersetzt und erläutert von Dr. Mendel Hirsch, Erster Teil: Bereschit (Basel: Verlag Morascha, 2008), 59.
[13] Benno Jacob, Das Buch Genesis, herausgegeben in Zusammenarbeit mit dem Leo Baeck Institut (Stuttgart: Calwer Verlag, 2000. Nachdruck des im Jahre 1934 im Schocken Verlag, Berlin erschienen Werkes: Das erste Buch der Tora. Genesis. Übersetzt und erklärt von Benno Jacob), 73.
[14] Joseph Herman Hertz, Pentateuch und Haftoroth. Hebräischer Text und deutsche Übersetzung mit Kommentar, Band 1: Genesis (Zürich: Verlag Morascha, 1984), 16.
[15] Carl Friedrich Keil und Franz Delitzsch, Die Bücher Mose’s. Erster Band: Genesis und Exodus (Leipzig: Dörfling und Franke, 3., verbesserte Auflage 1878), 46. C. F. Keil and F. Delitzsch, The Pentateuch: Genesis, Exodus 1-11, Commentary on the Old Testament vol.1/1. Transl. by James Martin (Peabody, Mass/USA: Hendrickson, 1989), 70.
[16] Samson Raphael Hirsch, Die Fünf Bücher der Tora mit den Haftarot, übersetzt und erläutert von Dr. Mendel Hirsch, Erster Teil: Bereschit (Basel: Verlag Morascha, 2008), 60.
[17] Yael Ziegler, Ruth. From Alienation to Monarchy. Yeshivat Har Etzion. Maggid Books (Jerusalem: Koren Publishers, 2015), 457.
[18] Ricklef Münnich <info@ahavta.com> in einer E-Mail vom Sonntag, den 27. November 2022 10:00 AM „Ausgabe #150“ mit dem Titel „ahavta+ || Zeugungen“.
[19] 1. Mose 10,32; 25,13; Ex 6,16.19; 28,10; 4. Mose 1,20.22.24.26.28.30.32.34.36.38.40.42; 1. Chronik 1,29; 5,7; 7,2.4.9; 8,28; 9,9.34; 26,31.
[20] Benno Jacob, Das Buch Genesis, herausgegeben in Zusammenarbeit mit dem Leo Baeck Institut (Stuttgart: Calwer Verlag, 2000. Nachdruck des im Jahre 1934 im Schocken Verlag, Berlin erschienen Werkes: Das erste Buch der Tora. Genesis. Übersetzt und erklärt von Benno Jacob), 74.
[21] Benno Jacob, Das Buch Genesis, herausgegeben in Zusammenarbeit mit dem Leo Baeck Institut (Stuttgart: Calwer Verlag, 2000. Nachdruck des im Jahre 1934 im Schocken Verlag, Berlin erschienen Werkes: Das erste Buch der Tora. Genesis. Übersetzt und erklärt von Benno Jacob), 73.
[22] in 1. Mose 25,12; das Wort bedeutet (Menge-Güthling [144]:) 1. Entstehung, Geburt, Abstammung, Abkunft, Herkunft; 2. Geschlecht, a) Familie, Stamm, Sippschaft, Verwandtschaft, Ahnenreihe, Stammbaum, b) Nachkommenschaft, Nachkomme, Kind, Sprößling, c) Geburtsort, Geburtsstätte, Heimat, Vaterland; 3) Menschenalter, Generation, Geschlecht; oder (Bauer [305-306]:) das Geschlecht; 1) die von einem Ahnherrn Abstammenden, Sippe, Sippschaft, Rasse; 2) die Reihe der gleichzeitig Geborenen, Generation, Zeitgenossen; 3) Zeitalter, Menschenalter, Zeit einer Generation; 4) Geschlecht oder Herkunft.
[23] in 2. Mose 6,16.19; 4. Mose 1,20.22.24.26.28.30.32.34.36.38.40.42; das Wort bedeutet (Menge-Güthling [642]:) 1. Verwandtschaft, Bluts- und Stammesverwandtschaft, Bande des Blutes; 2. die Verwandten, Sprößling, Familie, Geschlecht, Sippe, Stammvolk; oder (Bauer [1530]:) Verwandtschaft, die Verwandten.
[24] dieses Wort wird übersetzt mit (Menge-Güthling [145]:) Werden, Entstehen, Entstehung; 1. a) Zeugung, Erzeugung, Erschaffung, Geburt, Abstammung, Ursprung, Schöpfung, Dasein, Leben, Urquell; b) Verfertigung, Produktion; 2. etwas Erschaffenes: a) Schöpfung, Geschöpf. b) Geschlecht; oder (Bauer [306-307]:) 1. Entstehung, Ursprung, Abkunft, Geburt; 2. Dasein; 4. Werden, Lebenslauf.
[25] Wilhelm Gesenius, Hebräisches und Aramäisches Handwörterbuch über das Alte Testament, in Verbindung mit anderen bearbeitet von Frants Buhl (Unveränderter Neudruck der 1915 erschienen 17. Auflage: Berlin, Göttingen, Heidelberg: Springer-Verlag, 1962), 873. Carl Friedrich Keil und Franz Delitzsch, Die Bücher Mose’s. Erster Band: Genesis und Exodus (Leipzig: Dörfling und Franke, 3., verbesserte Auflage 1878), 46. Die fünf Bücher der Weisung, in Die Schrift. Verdeutscht von Martin Buber gemeinsam mit Franz Rosenzweig (Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft, 10., verbesserte Auflage der neubearbeiteten Ausgabe von 1954, 1976/1992), 12.
[26] Derek Kidner, Genesis. An Introduction and Commentary, TOTC (Leicester/England and Downers Grove, Illinois/USA: Inter-Varsity, 1989), 59.
[27] Joseph Herman Hertz, Pentateuch und Haftoroth. Hebräischer Text und deutsche Übersetzung mit Kommentar, Band 1: Genesis (Zürich: Verlag Morascha, 1984), 43.
[28] Derek Kidner, Genesis. An Introduction and Commentary, TOTC (Leicester/England and Downers Grove, Illinois/USA: Inter-Varsity, 1989), 59.
[29] Carl Friedrich Keil und Franz Delitzsch, Die Bücher Mose’s. Erster Band: Genesis und Exodus (Leipzig: Dörfling und Franke, 3., verbesserte Auflage 1878), 46.
[30] Benno Jacob, Das Buch Genesis, herausgegeben in Zusammenarbeit mit dem Leo Baeck Institut (Stuttgart: Calwer Verlag, 2000. Nachdruck des im Jahre 1934 im Schocken Verlag, Berlin erschienen Werkes: Das erste Buch der Tora. Genesis. Übersetzt und erklärt von Benno Jacob), 73.
[31] Samson Raphael Hirsch, Die Fünf Bücher der Tora mit den Haftarot, übersetzt und erläutert von Dr. Mendel Hirsch, Erster Teil: Bereschit (Basel: Verlag Morascha, 2008), 59.
[32] Carl Friedrich Keil und Franz Delitzsch, Die Bücher Mose’s. Erster Band: Genesis und Exodus (Leipzig: Dörfling und Franke, 3., verbesserte Auflage 1878), 46.
[33] Carl Friedrich Keil und Franz Delitzsch, Die Bücher Mose’s. Erster Band: Genesis und Exodus (Leipzig: Dörfling und Franke, 3., verbesserte Auflage 1878), 46. C.F. Keil and F. Delitzsch, The Pentateuch: Genesis, Exodus 1-11, Commentary on the Old Testament vol.1/1. Translated by James Martin (Peabody, Mass/USA: Hendrickson, 1989), 71.
[34] Benno Jacob, Das Buch Genesis, herausgegeben in Zusammenarbeit mit dem Leo Baeck Institut (Stuttgart: Calwer Verlag, 2000. Nachdruck des im Jahre 1934 im Schocken Verlag, Berlin erschienen Werkes: Das erste Buch der Tora. Genesis. Übersetzt und erklärt von Benno Jacob), 98.
[35] Ricklef Münnich <info@ahavta.com> in einer E-Mail vom Sonntag, den 27. November 2022 10:00 AM „Ausgabe #150“ mit dem Titel „ahavta+ || Zeugungen“.